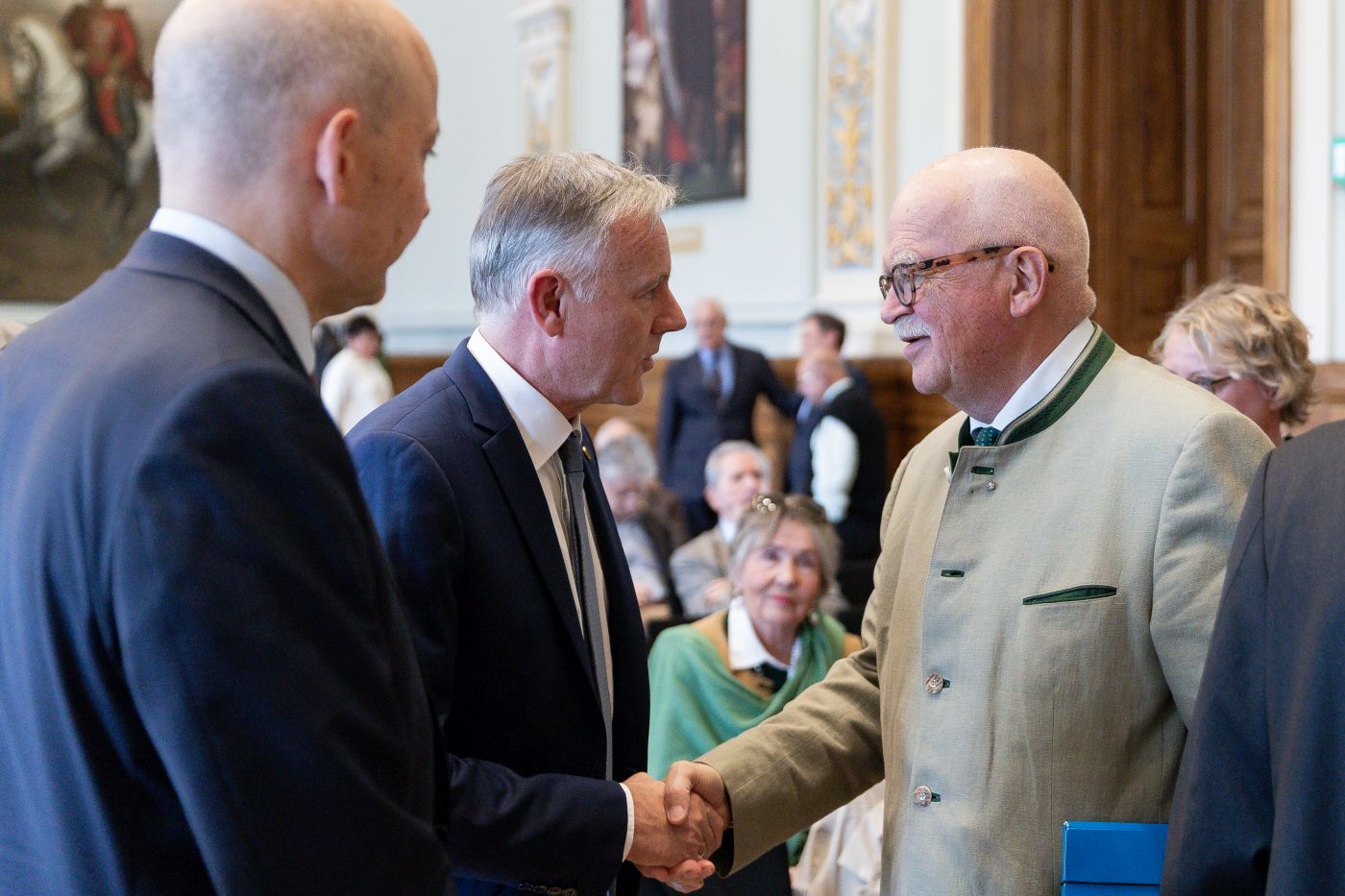Die Otto-von-Habsburg-Stiftung organisierte gemeinsam mit dem John-Lukacs-Institut an der Nationalen Universität für den Öffentlichen Dienst eine Konferenz zu Ehren von Franz Josef Strauss (1915–1988). In seiner Begrüßungsrede lobte Gergely Prőhle, Direktor unserer Stiftung und Programmdirektor des John-Lukacs-Instituts, Strauss‘ jahrzehntelange Bemühungen um die deutsche Einheit und wies unter Bezugnahme auf den Begriff der Subsidiarität aus dem Titel der Konferenz darauf hin, dass seine Ideen auch heute noch von großer Bedeutung sind, da Europa durch einen scharfen Konflikt zwischen integrationistischen und souveränitätsorientierten Kräften gespalten ist.
Gergely Gulyás erinnerte an die renaissancehafte Persönlichkeit von Strauss. Der CSU-Vorsitzende, der durch seine intensive Präsenz, seine herausragenden rhetorischen Fähigkeiten und sein charakteristisch populistisches Auftreten beeindruckte, setzte sich überzeugend für das von ihm oft vertretene Prinzip der doppelten Souveränität ein – der regionalen bayerischen und der deutschen Identität –, wobei er das Schicksal der mitteleuropäischen Nationen und die geopolitischen Realitäten berücksichtigte. Der Kanzleiminister schloss mit einem der Lieblingsbonmots von Strauss: „Irren ist menschlich, aber immer irren ist sozialdemokratisch.”
„Bayern ist meine Heimat, Deutschland mein Vaterland, Europa meine Zukunft“ – zitierte der Historiker Horst Möller den bayerischen Politiker. Der Redner zeichnete Strauss‘ Karriere nach, von seinen frühen Jahren bei Adenauer bis zu seiner Amtszeit als Bundesminister, in der er sich sowohl in der Atompolitik, als auch in der Verteidigung und Finanzpolitik einen wichtigen Beitrag leistete. Strauss war während seiner gesamten politischen Laufbahn ein konsequenter Verfechter des Bündnisses von CDU und CSU. Der renommierte Historiker beschrieb ihn als einen beeindruckenden Staatsmann, der sogar seine Niederlage im Kanzlerwahlkampf 1980 überwinden konnte. Während seiner Amtszeit als bayerischer Ministerpräsident (1978–1986) verfolgte er parallel zum Bundespolitik eine aktive Außenpolitik und trug zu vielen Ergebnissen bei, die die langfristige Zukunft seines Bundeslandes prägten.
In seinen beiden Büchern – Entwurf für Europa (1966), Herausforderung und Antwort. Ein Programm für Europa (1968) – fasste er seine Europapolitik zusammen. Darin brachte der Staatsmann seinen Glauben an die Souveränität der europäischen Völker und das Subsidiaritätsprinzip zum Ausdruck und forderte bereits damals, das unaufhaltsame Wachstum der Bürokratie einzudämmen. Seine Karriere verlief jedoch nicht ohne Fehler: Seine Zeitgenossen kritisierten bereits damals sein weniger herzliches Verhältnis zu Helmut Kohl, die Spannungen, die er wiederholt innerhalb der CSU schürte, und seine konfrontative Haltung gegenüber den Vertreter der Medien – deren Höhepunkt zweifellos die Spiegel-Affäre von 1962 war. Er galt daher nicht ohne Grund als Draufgänger der deutschen Politik, aber selbst seine Gegner bestritten nicht seine bemerkenswerten Fähigkeiten.
Die erste Referentin in dem historischen Überblick, Vanessa Conze, untersuchte die Beziehung zwischen Franz Josef Strauss und der Paneuropa-Union und ordnete die Bewegung in die ideologische Landschaft der europäischen Politik der 1970er Jahre ein. Otto von Habsburgs Präsidentschaft, die 1973 begann, belebte die damals noch wenig einflussreiche Gruppe neu, passte sie an die Herausforderungen der Zeit an und etablierte sie bald als Dachorganisation für christlich-konservative soziale Initiativen auf dem Kontinent. Strauss und die CSU erwiesen sich als einer der aktivsten, wenn nicht sogar als der aktivste Partner Ottos bei der Verfolgung dieser Ziele. Ihre Zusammenarbeit wurde durch die gegenseitige Sympathie der beiden Politiker erleichtert, trotz ihrer völlig unterschiedlichen soziokulturellen Hintergründe; Otto von Habsburg bezeichnete Strauss sogar wiederholt als Mentor. Und obwohl letzterer kein Mitglied der PEU war, erkannte er das Potenzial ihrer Partnerschaft und nutzte es in vielerlei Hinsicht, um seine eigenen Ziele zu erreichen.
Der Kalte Krieg war ein Schlüsselelement in den deutsch-deutschen Beziehungen dieser Zeit, da das Jalta-System auf der Teilung Deutschlands beruhte. Strauss sah Anfang der 1980er Jahre eine Chance, das kommunistische Regime zu destabilisieren, indem er sich für die angeschlagene ostdeutsche Wirtschaft engagierte, und es gelang ihm, einen zuvor undenkbaren Kredit in Höhe von einer Milliarde Mark zu vermitteln. Marco Gerhard Schinze-Gerber, Monograph des bayerischen Ministerpräsidenten, sprach darüber in seinem reich bebilderten Vortrag.
Nóra Szekér, Forscherin im Historischen Archiv der ungarischen Staatssicherheit, befasste sich mit der Wahrnehmung des CSU-Vorsitzenden während der Kádár-Ära. Sie zeigte auf, dass die ungarische Parteiführung aufgrund von Geheimdienstberichten ein realistisches Verständnis der „Zielperson” hatte und dass der diplomatische Hintergrund seines privaten Besuchs in Ungarn im Jahr 1977 ein Musterbeispiel für die sogenannte „Selbstständigkeit” der damaligen ungarischen Außenpolitik war. Diese Frage wurde von Andreas Schmidt-Schweizer, einem deutschen Historiker, weiter untersucht, der die Motive für die von Strauss geförderte bayerisch-ungarische Annäherung beleuchtete und deren Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Seiten erläuterte.
Bence Kocsev verwendete Auszüge aus der Korrespondenz zwischen Franz Josef Strauss und Otto von Habsburg, um ihre Beziehung zu präsentieren, die er – in Anlehnung an Max Weber – als „Wahlverwandtschaft“ zwischen Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Charakterzügen, gemeinsamen Zielen und umfassenden historischen und geografischen Kenntnissen beschrieb. Wie unser Kollege hervorhob, war die gegenseitige Abhängigkeit beiderseitig, da Ottos katholisch-konservativer Kosmopolitismus als passender Gegenpol zum sozialdemokratischen Internationalismus von Willy Brandt und der deutschen Linken dienen konnte.
Der Leiter des Brüsseler Büros der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) analysierte die Realpolitik von Franz Josef Strauss. Thomas Leeb porträtierte den CSU-Politiker, der seine Karriere seit seiner Jugend bewusst aufbaute, als entschlossenen Christdemokraten, der entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung seiner Partei und der Europäischen Volkspartei nahm. Sein offenherziger Antikommunismus, sein Engagement für die transatlantische Sache, das mit seinem Beharren auf der Integration eines Kontinents ohne die Sowjetunion einherging, und seine Unterstützung für die deutsch-französische Achse wurden durch sein Eintreten für eine gemeinsame europäische Verteidigungskraft ergänzt. Wenn diese Themen heute aktueller denn je sind, ist Strauss nicht derjenige, dem man die Schuld dafür geben kann.
Den Abschluss der Gedenkkonferenz bildete eine Podiumsdiskussion mit namhaften Vertretern der deutschen Politik der letzten fünfzig Jahre. Der ehemalige SPD-Bundesminister Klaus von Dohnanyi erinnerte in einer Videobotschaft aus seinem Haus in Hamburg an seinen politischen Weggefährten und unterstrich dessen Bedeutung mit der rhetorischen Frage: Was wäre Bayern heute ohne Strauss und was wäre Deutschland ohne Bayern? Peter Gauweiler, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und bayerischer Staatsminister, stellte Strauss‘ Werk in einem historischen Kontext vor und hob neben seiner Tätigkeit als Heeresorganisator auch seine außenpolitischen Ansichten und Initiativen hervor, die neben der offiziellen deutschen Diplomatie oft als unbequem unkonventionell galten. Aus diesem Grund, so Gauweiler, seien 70 Staaten bei der Beisetzung des Politikers vertreten gewesen, und sogar Erich Honecker habe lange Zeit überlegt, an der Trauerfeier teilzunehmen. Hans-Friedrich Freiherr von Solemacher, ehemaliger Leiter des HSS-Büros in Budapest, und Fritz Goergen, ehemaliger Bundesgeschäftsführer der FDP, zeichneten auf Fragen des Journalisten und Medienexperten Boris Kálnoky das Bild eines klardenkenden, scharfsinnigen Politikers, ohne den es für den Westen immer schwieriger geworden wäre, die Jahrzehnte des Kalten Krieges zu überstehen.