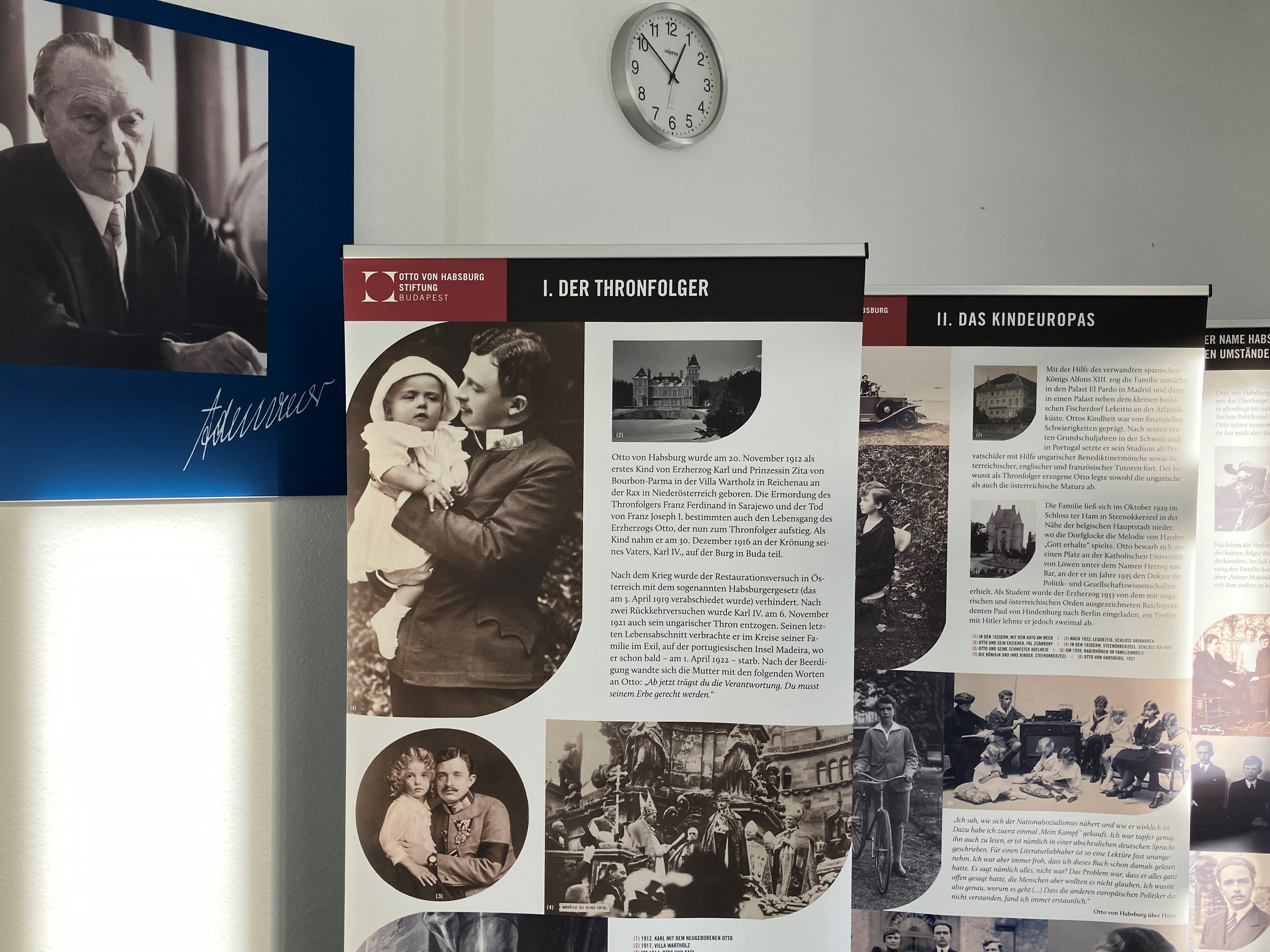Deutsche Stadtmarketing-Experten geben Städten oft einen festen Beinamen, um deutlich zu machen, welche historischen Persönlichkeiten die Gemeinde schätzt und wer dort einen kürzeren oder längeren Teil seines Lebens verbracht hat. Während es mehrere Bachstädte, Schillerstädte und Goethestädte gibt, gibt es nur eine einzige Ottostadt, nämlich Magdeburg, die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt. Dies bezieht sich aber nicht auf unseren Namensgeber Otto von Habsburg, sondern auf Otto I., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches (912–973). Gleichzeitig deuten ungarische historische Zusammenhänge und bestimmte biografische Details auf eine fast mystische Verbindung zwischen den beiden Ottos hin, die fast tausend Jahre auseinander geboren wurden. Otto I. widmete Gott die Gründung des Bistums Magdeburg nach seinem Sieg in der Schlacht von Lechfeld über die ungarischen Räuber im Jahr 955. Die Reiterstatue, die vermutlich ihn darstellt und um 1240 geschaffen wurde, ähnelt auffallend dem Bamberger Reiter, der als authentische Darstellung von König Stephan I. von Ungarn gilt und einige Jahrzehnte früher entstanden ist.
Der Magdeburger Reiter im Kulturhistorischen Museum Magdeburg (links). Der Bamberger Reiter im Ostchor des Bamberger Doms (rechts).
Obwohl dies allein schon Grund genug gewesen wäre, unsere Ausstellung „Lebensweg und Erbe“ in die südwestdeutsche Landeshauptstadt zu bringen, hatte die Einladung einen unmittelbareren und praktischeren Hintergrund. Reiner Haseloff (CDU), geboren in Wittenberg und seit 2011 Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, unterhält enge Beziehungen zu Ungarn, da seine Frau dort studiert hat. Wir trafen ihn mehrmals in Wittenberg während der Feierlichkeiten zum 500. Jahrestag der Reformation, und er besucht Ungarn oft auch privat. Bei einer solchen Gelegenheit überreichten wir ihm „99 Jahre – 99 Fotos: Fotografien aus dem Leben Otto von Habsburgs“ und diskutierten mit ihm über die historische Perspektive unseres Namensgebers sowie über seinen Einfluss auf die Grenzöffnung im Jahr 1989, an die man sich in Ostdeutschland noch heute öfters erinnert. So kam die Idee, dass dieser Moment auch in Magdeburg gewürdigt werden sollte. Die Vorbereitungen wurden von Stefan Gäbler, Kabinettsmitglied und Enkel des verstorbenen ungarischen Professors János Gulya aus Göttingen, der die Initiative seit langem unterstützt, erleichtert. Die Veranstaltung wurde vom Büro Sachsen-Anhalt der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) organisiert.
Positive Anlässe dieser Art sind in den heutigen deutsch-ungarischen Beziehungen selten, weshalb es besonders wertvoll ist, dass die Ausstellungseröffnung historische Reflexion mit dem aktuellen politischen und wirtschaftlichen Diskurs verband. Nach Begrüßungsworten von Rabea Brauer von der KAS und Vad Zoltán, stellvertretender Missionsleiter der ungarischen Botschaft in Berlin, hielt unser langjähriger Freund Róbert Fiziker, der Verbindungen zu Sopron hat, einen spannenden Vortrag über die Rolle Ungarns bei der deutschen Wiedervereinigung, in dem er die Bedeutung Otto von Habsburgs für das Paneuropäische Picknick und die weiteren historischen Entwicklungen hervorhob. In der anschließenden Podiumsdiskussion tauschten sich Andreas Müller von der örtlichen Industrie- und Handelskammer, János Ráduly, der seit 1972 in Magdeburg lebt, und Michael Knoppik, Bürgermeister des nahe gelegenen Ballenstedt, über die aktuelle wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Bundesland und Ungarn aus.
Zwischen einer Abstimmung im Landtag und einer Live-Fernsehübertragung in Berlin beehrte Reiner Haseloff mit seiner Anwesenheit die Veranstaltung. Trotz seines vollen Terminkalenders hielt er es für eine persönliche Priorität, das Wort zu ergreifen, und betonte, wie wichtig es sei, die Erinnerung an die Ereignisse von 1989 zu bewahren. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt betonte, dass man nicht vergessen dürfe, was damals geschehen sei, und dass man sich ebenso an den Freiheitskampf der ostdeutschen Bürger erinnern müsse wie an Papst Johannes Paul II., der es nicht zugelassen habe, dass durch eine Änderung der historischen Diözesangrenzen ein rein ostdeutsches Bistum entstanden sei, oder Otto von Habsburg, unter dessen Schirmherrschaft die Ereignisse vom August 1989 entlang des Eisernen Vorhangs wesentlich zur Beschleunigung der deutschen Wiedervereinigung beigetragen haben.
Bei der Eröffnung der Ausstellung wies Gergely Prőhle darauf hin, dass unser Namensgeber durch seine in Meiningen in der DDR geborene Frau ein genaues Bild von dem bis zum letzten Moment spürbaren Druck der kommunistischen Diktatur hatte, was ihn bei der Initiierung der Veranstaltung in Sopron ebenfalls motivierte. Abschließend wies er auf den ungebrochenen Optimismus von Otto von Habsburg hin, der auch in der heutigen Situation Kraft für die Kämpfe im öffentlichen Leben geben kann.