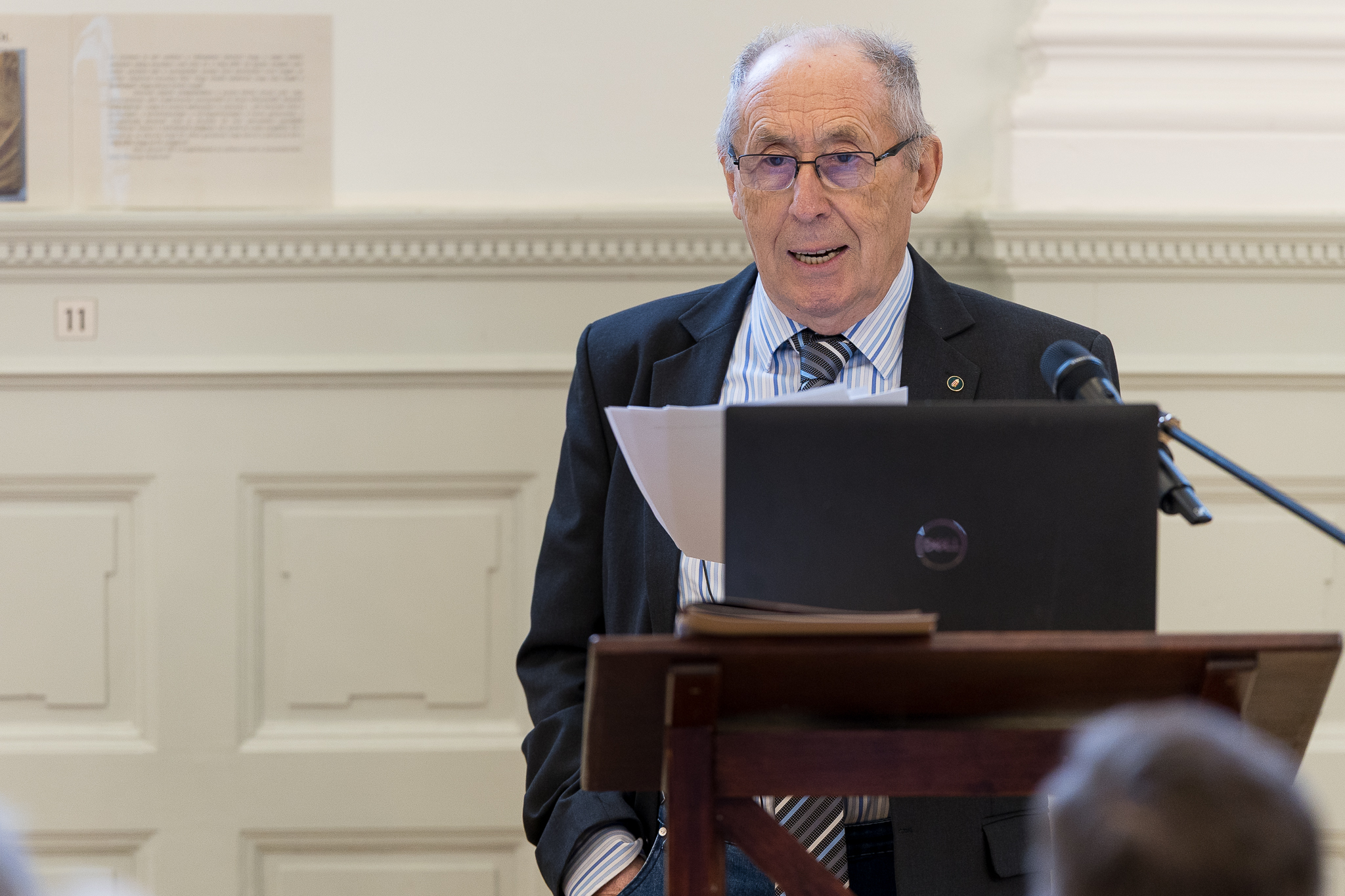Am 28. März widmeten die beiden Institutionen dem Politiker, Historiker und Publizisten eine wissenschaftliche Tagung. Der Eröffnungsvortrag von Botond Kertész, Leiter des Zentralarchivs der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn, beleuchtete anhand einer Reihe von Beispielen das kulturelle Phänomen des evangelischen Pfarrhauses. Vorbild ist Luthers Wohnhaus, das seit fünfhundert Jahren ein kultureller Topos für spirituelles und intellektuelles Wachstum unter Evangelischen ist und vielen Menschen, von Friedrich Nietzsche und Hermann Hesse bis Angela Merkel, von János Balassa bis Gábor Sztehlo, von Ľudovít Štúr bis Milan Hodža, als inspirierendes intellektuelles Umfeld diente.
Pál Pritz stellte in seiner allgemeinen Beschreibung der damaligen Zeit die Kraftfelder bildsam vor, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Ungarn wirkten. Gratz musste in dieser turbulenten Zeit seinen Überzeugungen treu bleiben, während seine Persönlichkeit zeitlebens von einer „viszeralen Abneigung gegen Umstürze“ und seine politischen Ansichten von einem supranationalen Liberalismus geprägt waren. Péter Csunderlik stellte Gratz‘ Lebenswerk ebenso in einen historisch-ideologischen Kontext. Der Professor der ELTE diskutierte die Stellung und Rolle Gratz‘ in der Gesellschaft für Sozialwissenschaften (Társadalomtudományi Társaság) und die Grundsatzdebatten innerhalb der Redaktion der Zeitschrift Huszadik Század, die schließlich 1906 zum Zerfall der Redaktion und zur Abspaltung des konservativen Flügels führten.
Róbert Fiziker vermittelte dem Publikum anhand zahlreicher Zitate einen Eindruck davon, wie Zeitgenossen und Nachwelt die Legitimisten sahen (eher ironisch). Ignác Romsics hingegen beleuchtete Gratz‘ Einschätzung der jüngeren Geschichte Ungarns, indem er die Werke des Politikers als Historiker untersuchte. In seinem monumentalen Überblick mit dem Titel Das Zeitalter des Dualismus (A dualizmus kora) steht Gratz eindeutig auf der Seite Deáks, da er der Ansicht ist, dass jede Änderung des Systems der Doppelmonarchie – sei es durch Föderalismus oder durch die Schaffung eines unabhängigen ungarischen Nationalstaates – den Zerfall des Staates nur beschleunigt hätte. In seinem Buch mit dem Titel Das Zeitalter der Revolutionen (A forradalmak kora) über die Jahre 1918–1919 wird das Voreingenommen des Historikers noch deutlicher: Er stellt nur die Leiter der Räterepublik in einem schlechteren Licht dar als Károlyi, und sein Stil gleitet oft ins Propagandistische ab. Gratz‘ politische Überzeugung kommt in seinem Buch mit dem Titel Ungarn zwischen den beiden Weltkriegen (Magyarország a két világháború között) zum Ausdruck, das erst zur Jahrtausendwende in Druckform erschien und mit seiner Kritik an Horthy und Bethlen und seiner Idealisierung von König Karl IV. vielleicht die konsequenteste und umfassendste legitimistische historiografische Darstellung dieser Zeit darstellt.
Fast anderthalb Jahrzehnte lang (1924–1938) war Gratz Präsident des Volksbildungsvereins in Ungarn (Német Népművelődési Egyesület) und bis 1933 gemeinsam mit Jakab Bleyer deren Mitdirektor. Der Vortrag von András Grósz trug dazu bei, die Eckpfeiler der unterschiedlichen Ansätze der beiden Männer, nämlich Staatsgemeinschaf tversus Volksgemeinschaft, zu verdeutlichen. Ferenc Eiler erzählte den weiteren Verlauf der Ereignisse: Die Minderheit in Ungarn war nicht immun gegen den Einfluss des Dritten Reiches auf die deutsche Bevölkerung der Region; aus dem Kampf zwischen der Position des legitimistischen Politikers und der Haltung der radikalen neuen Generation ging Letztere als Sieger hervor.
Zuletzt zeichnete Vince Paál die Persönlichkeit von Adolf Gusztáv Gratz, einem Mann voller Bescheidenheit und Ehrgeiz. Sein legendärer Fleiß, gepaart mit großer Genauigkeit, erklärt, wie Gratz in allen Bereichen, in denen er tätig war – als Journalist, Politiker und Historiker –, bleibende Spuren hinterlassen konnte. Seine Akzeptanz durch seine Zeitgenossen war zweifellos auch seiner Kompromissbereitschaft in Konfliktsituationen zu verdanken. Er wurde von seinem legitimistischen Freund Sándor Pethő nicht nur wegen seiner tiefen Kenntnisse der Geschichtsphilosophie geschätzt, sondern auch, weil er Gratz als aufrichtigen Verfechter der alten ungarischen Tradition und gleichzeitig als einen Mann betrachtete, der moderne, fortschrittliche Ideen in sein Denken integrieren konnte.
Gergely Prőhle, Direktor der Stiftung und Laienpräsident der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn, dankte der Nationalen Medien- und Infokommunikationsbehörde und persönlich Präsident András Koltay: Mit ihrer Unterstützung wird der Luther-Verlag in Kürze eine ungarische Übersetzung der Memoiren von Gusztáv Gratz veröffentlichen, die bisher nur in deutscher Sprache erhältlich waren.
Fotos: Márton Magyari