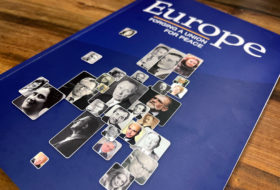Zwanzig Jahre lang setzte sich der ehemalige Thronfolger mit großem Engagement für die Einheit des Alten Kontinents, für demokratische Werte und für die Stärkung des Einflusses Europas in der Weltpolitik ein. Mit seinem überragenden diplomatischen Gespür und seinem Engagement hat er die europäische Politik maßgeblich beeinflusst, insbesondere bei der Vorbereitung der Integration der mitteleuropäischen Länder.
„Hier hat man wenigstens das Gefühl, einer nützlichen Sache zu dienen.“
Mit diesem Satz beendete Otto von Habsburg Ende Oktober 1979 seinen Brief an den damals schon Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich August von Hayek. Darin teilte er seinem berühmten Freund mit, dass er ab Sommer desselben Jahres seine öffentliche Tätigkeit als Mitglied des Europäischen Parlaments fortsetzen werde. Der kurze Satz macht deutlich, dass der ehemalige Thronfolger große Hoffnungen hegte, dass die von nun an direkt gewählte Versammlung die Geschicke des Kontinents mitgestalten könnte.
Der Frühsommer 1979 war in der Tat ein Meilenstein in der Geschichte der europäischen Integration. Obwohl die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Laufe der Jahre wirtschaftlich und politisch erheblich an Bedeutung gewonnen hatte, wurde sie wegen des Demokratiedefizits ihrer Institutionen öfters kritisiert. Eine Reihe von Konzepten und Strategien zur Behebung dieses Mangels – insbesondere zur Reform der Rolle des Parlaments und der Art und Weise, wie es gewählt wurde – waren seit Ende der 1950er Jahre ausgearbeitet worden, aber Interessenkonflikte zwischen den europäischen Institutionen hatten lange Zeit ihre Umsetzung verhindert. Diese Konflikte wurden schließlich gelöst, indem die Frage der Wahl des Parlaments zumindest vorübergehend von der Frage der Ausweitung der institutionellen Befugnisse getrennt wurde. Die ersten Direktwahlen, die ursprünglich für den Herbst 1978 vorgesehen waren, fanden fast ein Jahr später, im Juni 1979, statt, als die Bürgerinnen und Bürger der EWG, der zu Beginn des Jahrzehnts neun Mitgliedstaaten angehörten, darunter Großbritannien, Irland und Dänemark, zum ersten Mal über die Zusammensetzung des 410 Mitglieder zählenden Organs entscheiden konnten. Um die demokratische Legitimation zu erhöhen, taten nicht nur die politische Elite, sondern auch Vertreter der Zivilgesellschaft – Kirchen, Gewerkschaften und verschiedene soziale Initiativen – viel, um die Wähler zu mobilisieren und eine Art europäischen Demos zu schaffen: beliebte Politiker machten eine ,,Tournee“ durch die Nachbarländer, europäische Festivals und Konzerte versuchten, die Idee einer imaginären europäischen Gemeinschaft zu stärken. An den Wahlen, die zwischen dem 7. und 10. Juni stattfanden, beteiligten sich 62 % der 184,5 Millionen wahlberechtigten Bürger.
Die konstituierende Sitzung des neuen Europäischen Parlaments fand einige Wochen später in Straßburg statt, wo die Abgeordneten Simone Veil aus Frankreich zur Präsidentin wählten. Veil war in vielerlei Hinsicht eine Symbolfigur. Sie hatte die Konzentrationslager der Nazis überlebt, war nach dem Krieg eine Frauenrechtlerin, setzte sich für die deutsch-französische Aussöhnung ein und engagierte sich stark für den Erfolg und die weitere Erweiterung der europäischen Integration. Die zweimal wiedergewählte Simone Veil und Otto von Habsburg waren bis 1993 Kollegen im Europäischen Parlament.
Für unseren Namensgeber war es nicht selbstverständlich, einen Sitz im Europäischen Parlament zu erlangen, da er bis 1978 gar kein Bürger eines EWG-Mitgliedstaates war. Schließlich erhielt er die Staatsbürgerschaft und konnte sich in der Bundesrepublik Deutschland, in dem Bezirk seines Wohnsitzes in Pöcking zur Wahl stellen. Dies führte dazu, dass er auf dem dritten Platz der Liste der Christlich-Sozialen Union in Bayern (CSU), die bei den Wahlen 1979 acht Sitze errang, in das Europäische Parlament gewählt wurde. Seine Kandidatur – obwohl die Idee, einer CSU-Legende zufolge, von der grauen Eminenz der Partei, Heinrich Aigner, stammte – war eine bewusste Entscheidung von Franz Josef Strauß. Der Politiker, der nach seiner Bonner Ministerzeit Ministerpräsident des Freistaats Bayern geworden war, wusste, dass die führende Partei des Landes, die sich im Zuge der industriellen Modernisierung in den 1960er und 1970er Jahren zu einem immer wichtigeren bundes- und weltpolitischen Akteur entwickelte, ihre herausragende Stellung nur dann halten konnte, wenn sie nicht nur mit dem sozioökonomischen Strukturwandel der Zeit Schritt hielt, sondern auch ihre politischen Ambitionen und Horizonte über die Grenzen des lokalen öffentlichen Lebens hinaus zu erweitern vermochte. Otto von Habsburg erwies sich für die Verwirklichung des letztgenannten Ziels als die perfekte Wahl, da seine außergewöhnliche internationale Ausrichtung und seine beispiellose politische und diplomatische Erfahrung ihn in die Lage versetzten, die Interessen Bayerns über die Grenzen der Region hinaus wirksam zu vertreten, und sein einzigartiges Charisma ihn zu einem der beliebtesten europäischen Politiker seiner Partei machte.
Der eigenartige ,,Kosmopolitismus“ Otto von Habsburgs unterschied sich jedoch stark von dem obskuren Internationalismus der Sozialdemokraten – und ihres Listenführers, des ehemaligen Bundeskanzlers Willy Brandt –, die ihre Kampagne auf die Diskreditierung des ehemaligen Thronfolgers aufgebaut hatten. Sein Realismus und Pragmatismus, subtil verwoben mit moralischen Erwägungen, die den traditionellen christlichen Werten treu bleiben und jede Form von politischem Extremismus ablehnen, während sie die weitere Vertiefung und Erweiterung der europäischen Integration unterstützen, kamen bei den bayerischen Wählern gut an. Der ehemalige Erzherzog, der sich im Laufe der Jahre als Meister der demokratischen Politisierung erwiesen hat, hat bereits in seinem ersten Wahlkampf bewiesen, dass Tradition und modernes öffentliches Engagement nicht nur vereinbar sind, sondern dass seine historische und dynastische Erfahrung und sein Bewusstsein eine Ressource darstellen, die der Entwicklung der Region, des Landes und des Kontinents dienen kann.
Ein Teil der Dokumente über die Tätigkeit Otto von Habsburgs im Europäischen Parlament wird von unserer Stiftung verwahrt. Die richtige Interpretation und Aufarbeitung dieser Quellen werden durch die Erinnerungen seiner ehemaligen direkten Mitarbeiter wesentlich unterstützt. Wir haben auch ausgezeichnete Beziehungen zu mehreren ehemaligen Assistenten Otto von Habsburgs, von denen uns viele Relikte aus den Europawahlkämpfen zur Verfügung gestellt haben. Kürzlich schickte Knut Abraham – ein aktueller Bundestagsabgeordneter (CDU), der zwischen 1987 und 1996 mit unserem Namensgeber zusammengearbeitet hatte, ab 1994 in Brüssel – unserer Stiftung eine Tonaufnahme von Ottos Wahlkampfrede im März 1979 sowie einige Plakate und anderes Werbematerial. Unsere wachsende Sammlung von Objekten und die fortlaufende Aufarbeitung von Archivquellen ermöglichen es uns, das politische Profil des ehemaligen Thronfolgers, der Europaabgeordneter wurde, so genau wie möglich darzustellen.
Aus den Dokumenten im Archiv unserer Stiftung ergibt sich das Bild eines Mannes, der den Konsens suchte, den Dialog mit seinen politischen Gegnern suchte, aber immer seinen Prinzipien treu blieb. Otto von Habsburg trat in der Zeit der sogenannten Eurosklerose in die europäische Politik ein und setzte sich in der Wendezeit, in den 1990er Jahren und in der euphorischen Ära des Maastrichter Vertrages für ein geeintes, christliches und soziales Europa ein.
Unter seinen zahlreichen Reden, Vorschlägen und vorgeschlagenen Beschlüsse sind die bekanntesten und charakteristischsten diejenigen, die sich auf den Abbau des Eisernen Vorhangs, die Lage und den politischen Wandel in Mittel- und Osteuropa, einschließlich der Auflösung der Sowjetunion und Jugoslawiens, die Vereinigung der beiden deutschen Staaten und insbesondere die Osterweiterung der Europäischen Union beziehen. Seine Unterstützung beschränkte sich jedoch keineswegs auf die Länder Mittel- und Osteuropas: Er unterstützte nachdrücklich die Erweiterungsrunden von 1981 (Griechenland), 1986 (Portugal, Spanien) und 1995 (Österreich, Finnland, Schweden) mit dem Argument, dass der Beitritt jedes neuen Mitgliedstaates das europäische Projekt weiter beleben und stärken würde.
Sein Interesse war jedoch noch breiter angelegt und konzentrierte sich neben der Erweiterung auf viele andere Bereiche. Er setzte sich insbesondere für die europäische Sicherheit und die Schaffung gemeinsamer europäischer Institutionen ein, beschäftigte sich aber auch intensiv mit wirtschaftlichen (Weltwirtschaftstrends und Entwicklungspolitik, Ausweitung des Konzepts der sozialen Marktwirtschaft über Deutschland hinaus), sozialen (Wandel der Schicht- und Klassenstrukturen, Situation der Entwicklungsländer) und ökologischen (Klimawandel, Tierschutz) Fragen.
Obwohl unser Namensgeber nicht zu den ,,Gründervätern“ gehörte und keine führende europapolitische Position innehatte, spielte er in seiner zwei Jahrzehnte währenden parlamentarischen Laufbahn eine herausragende Rolle in der Geschichte der Integration. Ungefähr zur Wendezeit bekannte Otto von Habsburg in einem Interview mit dem Chatham House Magazin mit tiefer Überzeugung:
„Ich danke Gott, dass ich Mitglied des Europäischen Parlaments sein darf.“
Seine Worte spiegeln wahrhaftig sein Engagement und seine Leidenschaft für ein einheitliches und demokratisches Europa wider, und seine parlamentarischen Aktivitäten inspirieren nach wie vor das politische Denken und die politische Praxis sowohl im eigenen Land als auch in Europa.
Anlässlich des Jubiläums gedenkt unsere Stiftung des engagierten Wirkens und des Erbes ihres Namensgebers in Europa mit einer Reihe von fachlichen und öffentlichen Veranstaltungen im In- und Ausland.
Bence Kocsev
Gergely Fejérdy